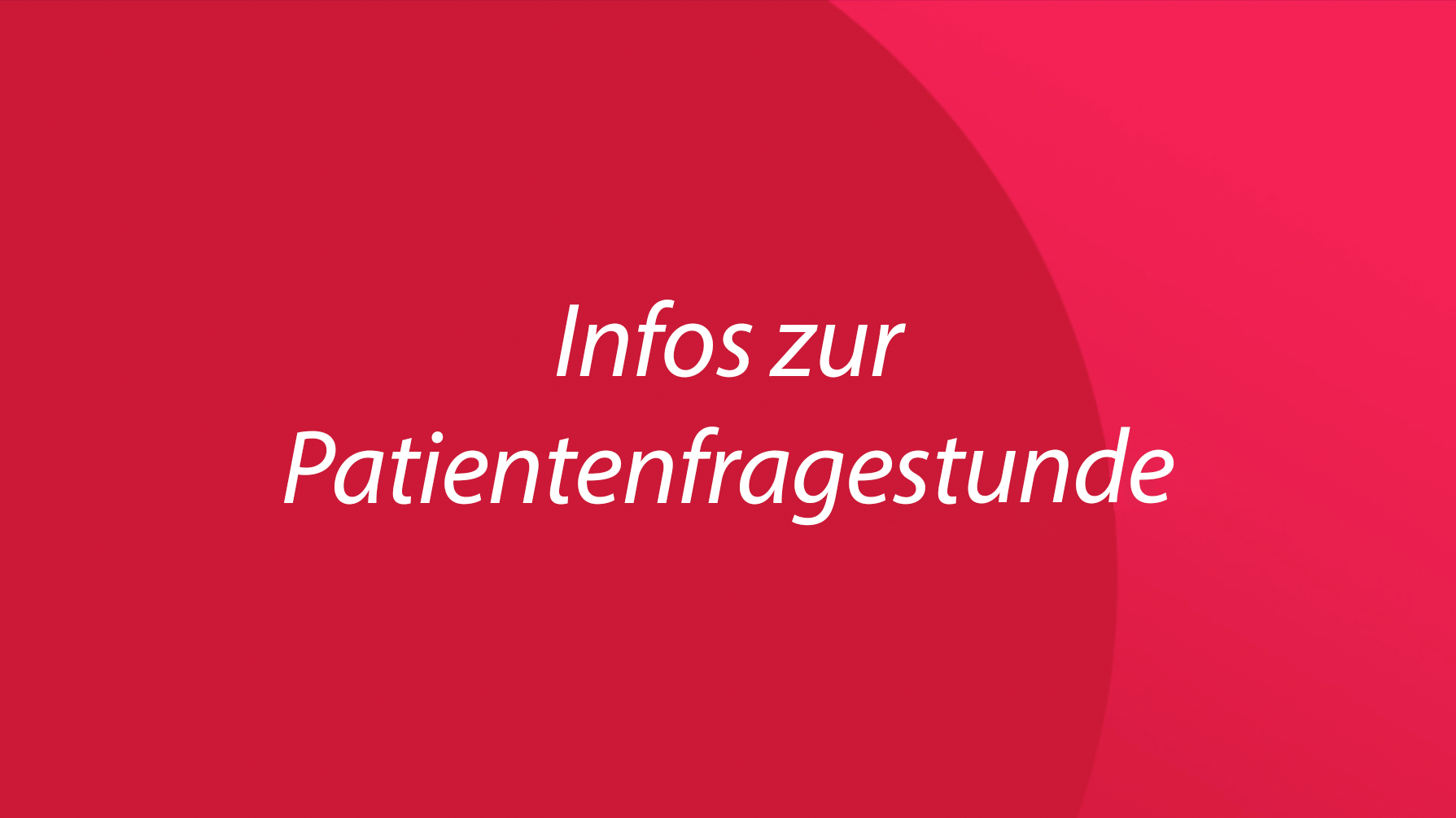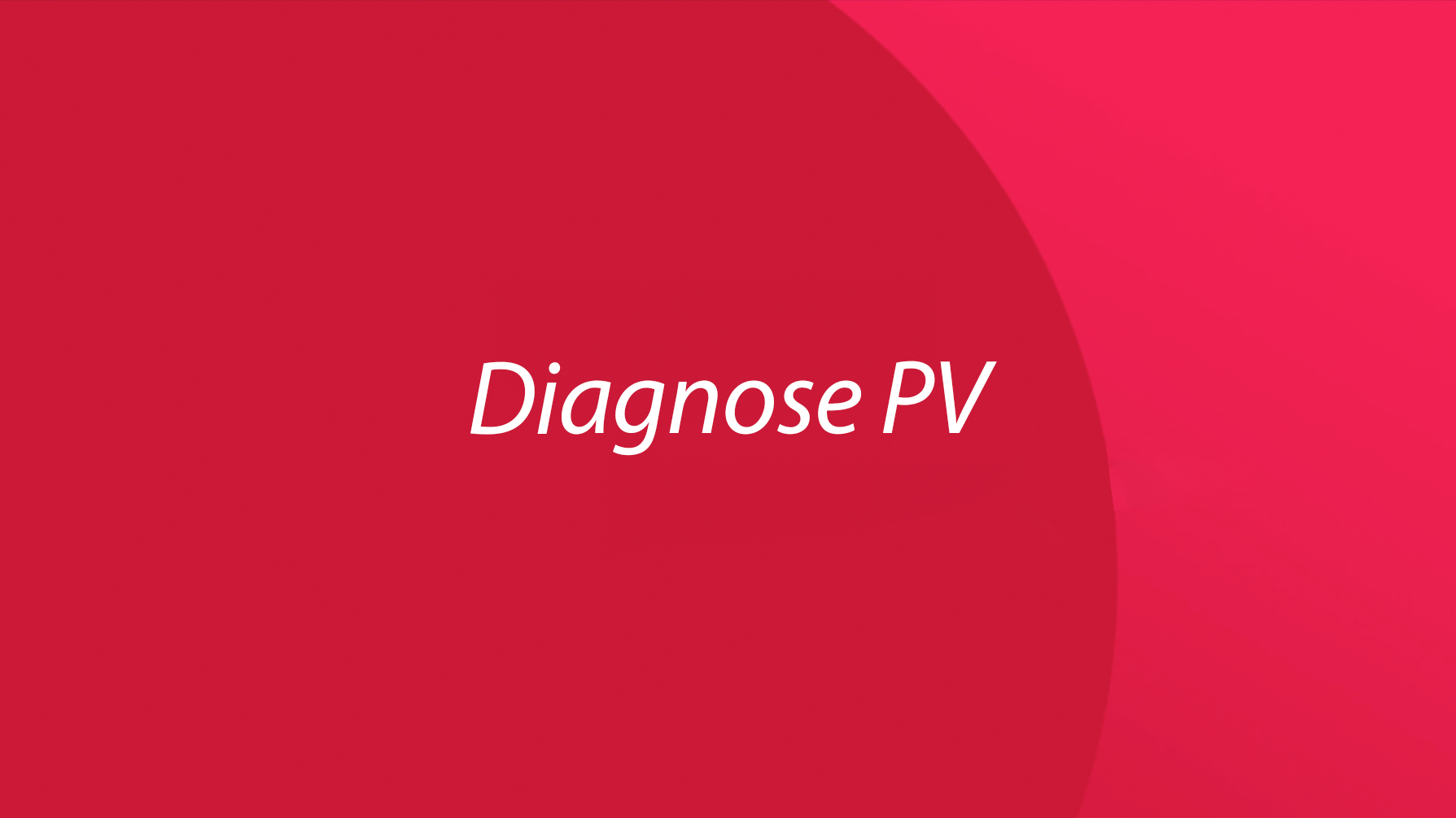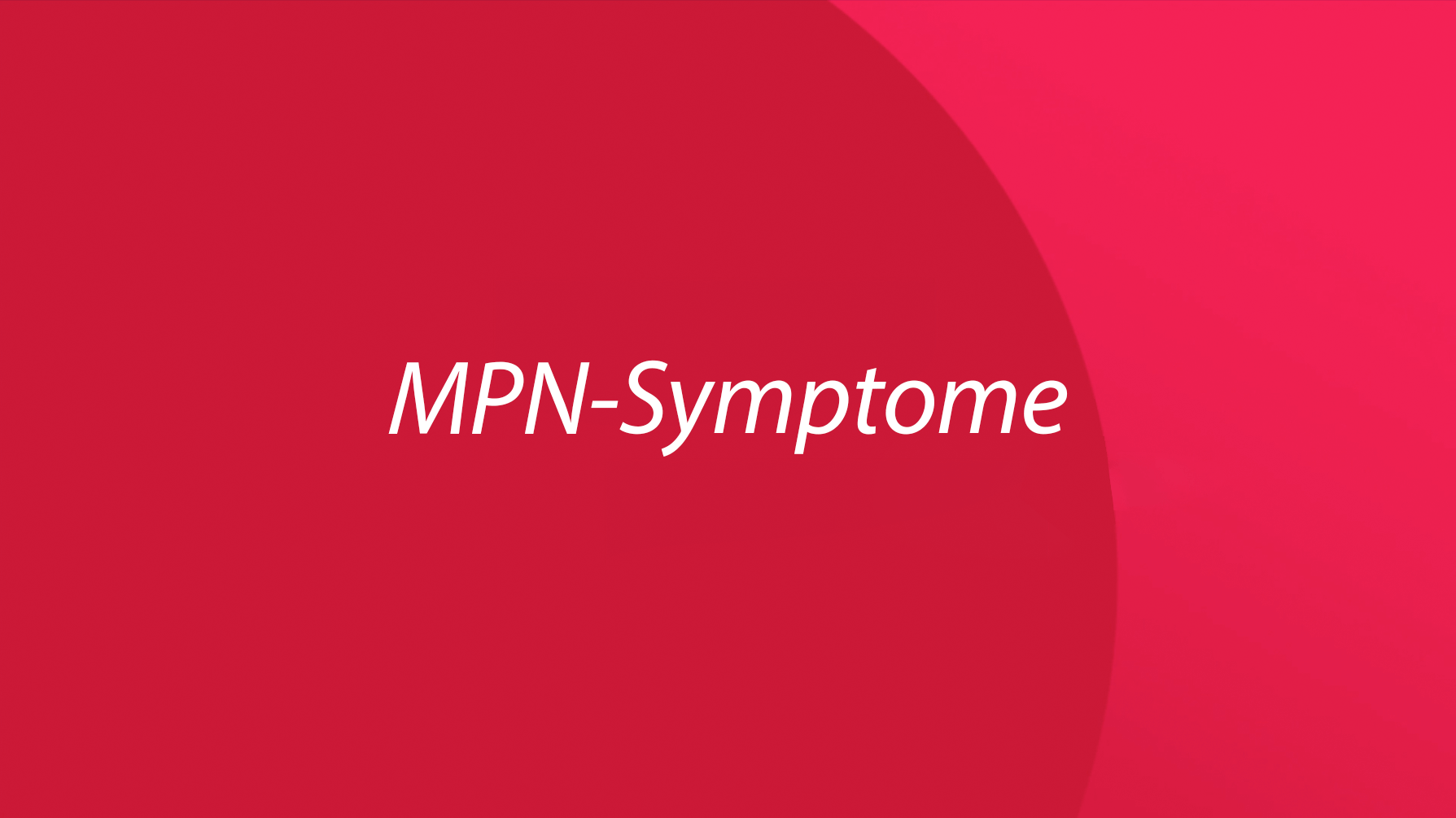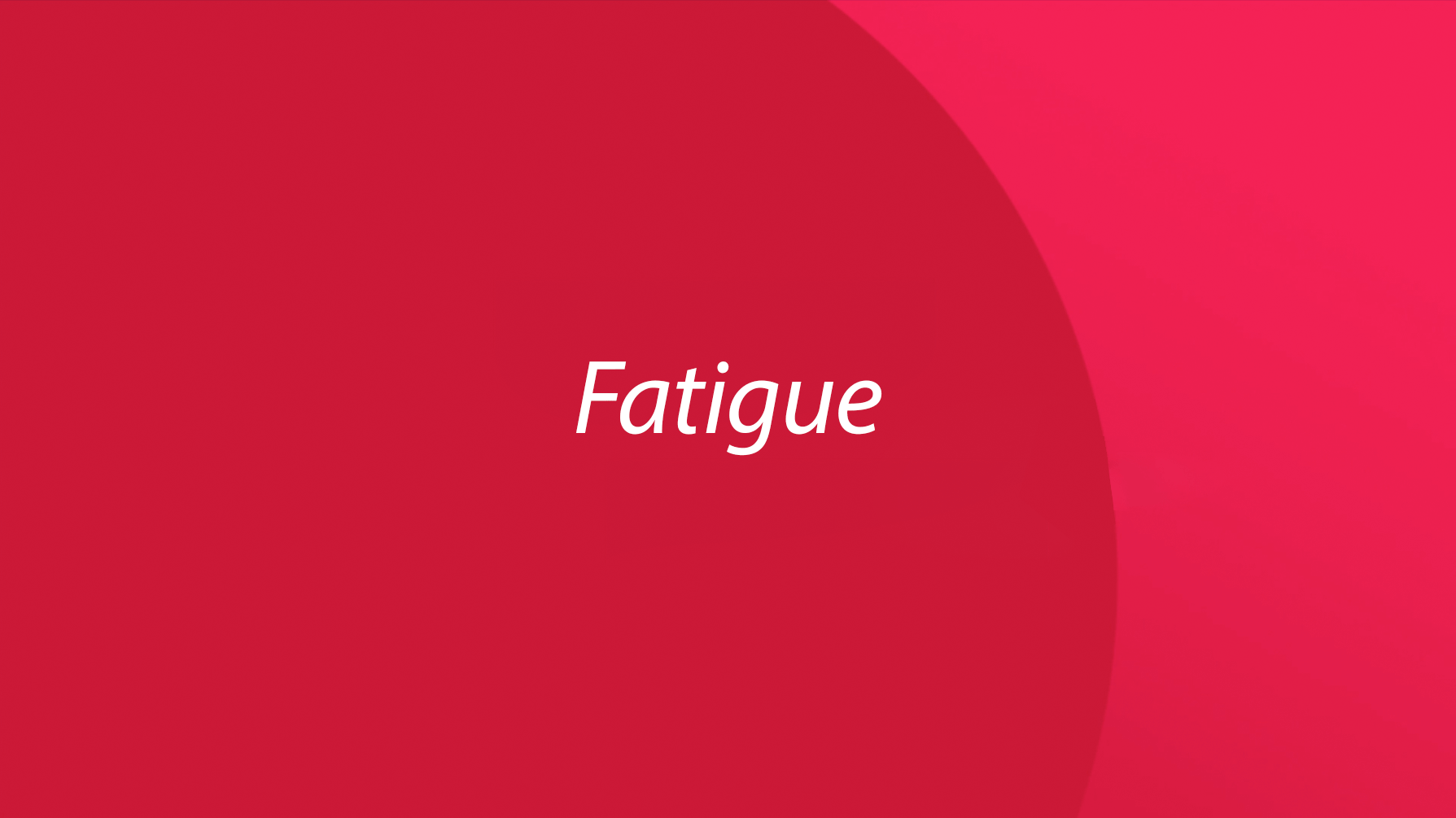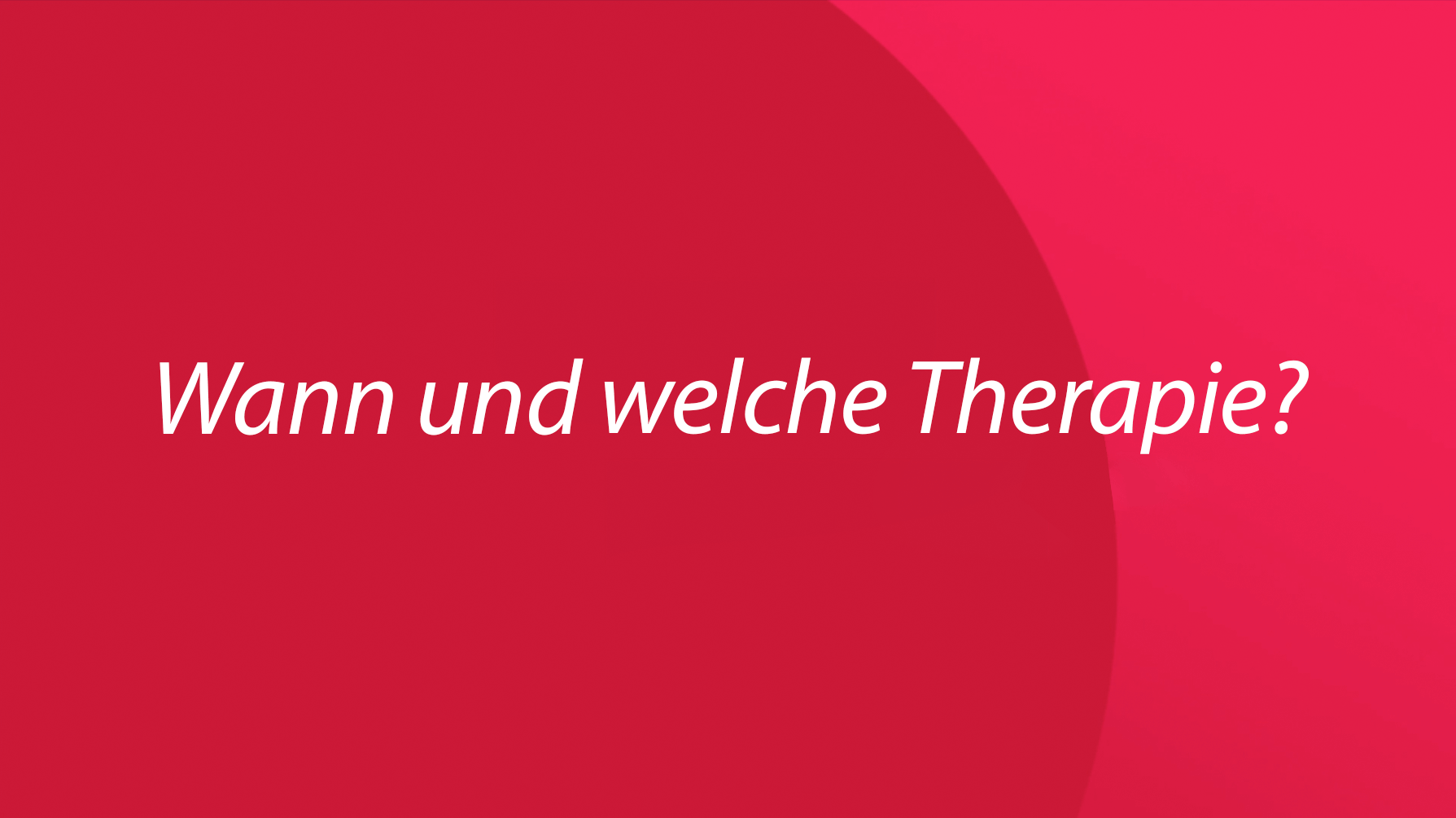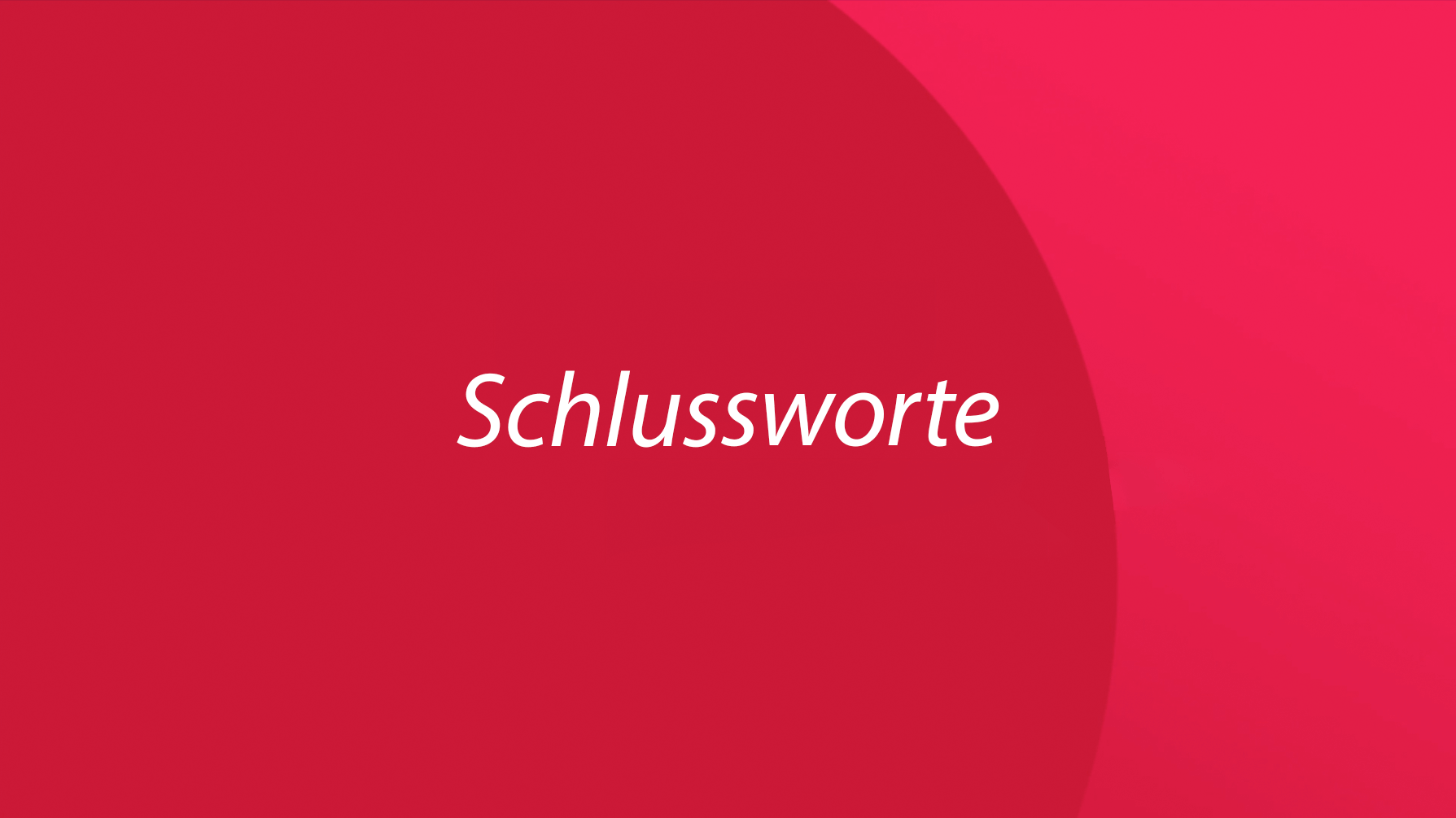Über Ask an Expert
„Ask an Expert“ bietet Patient:innen die Chance, ihre individuellen Fragen zur seltenen Erkrankung Polycythaemia Vera (PV) an erfahrene Experten in dieser Indikation zu stellen. Denn das Leben mit PV stellt Betroffene vor viele Herausforderungen. Oft fühlen sich Patient:innen unsicher hinsichtlich des Krankheitsverlaufs oder verfügbarer Behandlungsmöglichkeiten. Dann stellen Sie jetzt Ihre Fragen zur PV an unsere Experten.
Die Unternehmensgruppe AOP Health, die sich als europäischer Pionier dem Bereich integrierter Therapien für seltene Erkrankungen und Intensivmedizin widmet, bietet die Reihe „Ask an Expert“ mit ausgewiesenen Experten auf dem Fachgebiet der myeloproliferativen Erkrankungen an.
Patientensprechstunde am am 28.Februar 2025
Zum Anschauen der Aufzeichnung klicken Sie hier einfach eine Kachel an, dann startet direkt das Video.
Nächster Termin:
Experten beantworten Ihre Fragen zur Erkrankung Polycythaemia Vera.
Patientensprechstunde am 07. Oktober 2025 von 17 bis 18 Uhr.
Infos zur Patientenfragestunde
Prof. Dr. Andreas Reiter, Leiter des Exzellenzzentrums für myeloproliferative Neoplasien, Mannheim begrüßt die Teilnehmenden zur 8. Ausgabe der Veranstaltung „Ask an Expert“ am 28. Februar 2025, zum Thema „Myeloproliferative Neoplasien (MPN)“ und speziell zur Polycythaemia Vera (PV).
Außerdem mit dabei ist Prof. Dr. Martin Grießhammer, Direktor der Universitätsklinik für Hämatologie, Onkologie, Hämostaseologie und Palliativmedizin am Johannes Wesling Klinikum Minden.
Die Veranstaltung wird v. a. die aktuell eingegangen Fragen, welche die Webinar-Teilnehmenden vorab online oder über die Chat-Funktion stellen, berücksichtigen. Unsere Experten teilen mit Ihnen ihre Erfahrungen aus dem Praxisalltag. Komplexere Fälle können nicht ausführlich besprochen werden, aber die Teilnehmenden werden ermutigt, persönlich Kontakt zu den Referenten aufzunehmen. Die Aufzeichnungen aller bisherigen Patientensprechstunden aus den Jahren 2022 bis 2024 sind auf der Website https://ask-an-expert-live.de verfügbar.
Diagnose PV
Hier fassen die beiden Experten die Aspekte zusammen, die bei einer PV-Diagnose von Relevanz sind.
Prof. Reiter erläutert, dass für die Diagnose der PV erhöhte Hämoglobin- und Hämatokrit-Werte vorliegen müssen. Hier ist jedoch jeder Patient und jede Patientin anders: Es gibt auch Menschen mit PV, deren Werte im Normalbereich liegen. Es gibt, so Prof. Grießhammer, noch weitere Einflüsse auf den Hämatokrit-Wert, wie z. B. Blutungen, chronischer Blutverlust oder Eisenmangel, die den tatsächlichen Wert verfälschen können.
Anhand welcher Kriterien kann trotzdem eine PV diagnostiziert werden? Laut den beiden Experten gehören dazu das Auftreten von Thrombosen, eine vergrößerte Milz und andere auffällige Blutbildveränderungen, wie eine erhöhte Zahl an roten Blutkörperchen, sowie eine Mutationsanalyse und eine Knochenmarkpunktion. Außerdem kann eine Komplettanalyse des Eisenhaushaltes (Ferritin, Transferritinsätting etc.) unterstützen.
Die beiden Experten sind sich einig: Manchmal ist es nicht einfach, eine PV zu diagnostizieren, und oft wird erst im (späten) Krankheitsverlauf festgestellt, dass es sich um eine PV handelt.
Eisenhaushalt
Die beiden Experten sprechen über die Relevanz des Eisenhaushaltes bei PV.
Normalerweise ist der Ferritin-Wert bei Patient:innen mit PV im Normalbereich oder liegt darunter. Allerdings kann er durch verschiedene Faktoren erhöht sein. Dazu zählt Prof. Grießhammer u. a. angeborene Eisenstoffwechselerkrankungen (z. B. Hämochromatose) und Entzündungen, wie chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, auf. Denn: Ferritin spiegelt nicht nur den Eisenhaushalt wider, sondern wird auch durch (chronische) Entzündungen beeinflusst.
Prof. Reiter erläutert, dass die Hämochromatose eine angeborene Erkrankung ist, bei der es zu einer Steigerung der Eisenaufnahme kommt. Liegt sowohl eine PV als auch eine Hämochromatose vor, entzieht die Blutbildung zusätzlich Eisen. Daher erfordert die Therapie, insbesondere bei Aderlässen, eine sorgfältige Überwachung der Ferritin- und Eisenwerte, um individuell zu bestimmen, wie viele Aderlässe notwendig sind.
Eine eisenreduzierte Ernährung, etwa vegetarisch oder vegan, kann zu einem Vitamin-B12-Mangel führen, der für die Blutbildung wichtig ist, so Prof. Reiter. Obwohl eine solche Ernährungsweise möglich ist, sollte sie gut überwacht werden, insbesondere bei Aderlässen. Insgesamt spielt die Ernährungsweise allerdings eine untergeordnete Rolle, da der Körper nur begrenzt Eisen aufnimmt, selbst bei hohem Fleischkonsum.
Auch hier schlussfolgern beide Experten: Ein hoher Ferritin-Wert bei PV ist daher kein Widerspruch, auch wenn eine andere Konstellation häufiger vorkommt.
MPN-Symptome
Prof. Reiter und Prof. Grießhammer besprechen die Symptome von myeloproliferativen Neoplasien (MPN).
Laut den beiden Experten gibt es Symptome bzw. Symptomkonstellationen, die spezifisch für eine PV sind, andererseits aber auch einige unspezifische Anzeichen, die eine Einordnung erschweren.
Einige Symptome sind schwerer einzuordnen, besonders Fatigue, die durch die Krankheit selbst, die Therapie, den Alltag oder Eisenmangel (z. B. durch Aderlässe) verursacht werden kann. Auch Anzeichen wie Mikrozirkulationsstörungen, Schwindel oder Tinnitus sind unspezifisch und sollten unter Berücksichtigung von Alter und kardiovaskulären Risikofaktoren (z. B. Bluthochdruck, Adipositas, Gefäßverkalkungen) bewertet werden. In komplexen Fällen kann es sinnvoll sein, Fachkollegen, etwa aus der Kardiologie, hinzuzuziehen.
Prof. Reiter erklärt: Ein ausgeprägter Juckreiz ist typisch für eine PV und macht eine zusätzliche Erkrankung eher unwahrscheinlich. Auch eine starke Rotfärbung der Hände und Füße in Kombination mit Durchblutungsstörungen, wie beim Raynaud-Syndrom, spricht bei PV meist für die Krankheit selbst und nicht für eine andere Ursache.
Fatigue
Prof. Reiter und Prof. Grießhammer sprechen hier über Fatique als Symptom bei Patient:innen mit PV.
Bei PV kann das chronische Erschöpfungssyndrom, auch Fatigue genannt, ein großes Problem sein. Das Auftreten von Fatigue bei einer gut kontrollierten PV kann von einem Eisenmangel herrühren. Daher kann in bestimmten Fällen eine vorsichtige orale Eisen-Substitution erwogen werden, insbesondere bei schwerer Fatigue. Dabei sind regelmäßige Kontrollen essenziell. Die Gabe von intravenösem Eisen sollte vermieden werden [Anm. iv-Eisengabe ist streng kontraindiziert], erläutert Prof. Reiter.
Prof. Grießhammer ermutigt: Da jeder Patient unterschiedlich reagiert, erfordert die Behandlung Erfahrung und individuelles Ausprobieren. Zudem können auch Maßnahmen wie Bewegung und Sport helfen.
Wann und welche Therapie?
Die beiden Experten diskutieren, wann und welche Therapie sinnvoll sein kann.
Prof. Reiter fasst bzgl. der Diagnose einer PV zusammen: Eine Knochenmarkpunktion ist wichtig für die Diagnose und Therapieplanung der Polycythaemia Vera (PV) und sollte idealerweise frühzeitig durchgeführt werden. Zudem ist die Bestimmung der Allel-Last essenziell, da eine hohe Allel-Last mit thromboembolischen Risiken verbunden ist und unter Therapie überwacht werden sollte. Zur Diagnosestellung gehören Blutbild, Knochenmarkpunktion, Allel-Last und das supprimierte Erythropoetin.
Bei welchen Patient:innen wird mittels Aderlass als Basistherapie behandelt, und bei welchen sollte eine medikamentöse Therapie in Betracht gezogen werden? Mit der neuen Leitlinie haben sich die Kriterien geändert, erzählt Prof. Grießhammer Zu den Risikofaktoren, die Einfluss auf die Therapieentscheidung haben, gehören aktuell u. a. das Alter, vorherige Thromboseereignisse, kardiovaskuläre Risikofaktoren, die Milzgröße, die Häufigkeit des Aderlasses und die Anzahl der weißen Blutkörperchen.
Prof. Grießhammer stellt jedoch infrage, ob es bei einer klonalen Erkrankung wie der PV sinnvoller ist, nur mit Aderlass und Acetylsalicylsäure zu behandeln, anstatt die Krankheitsprogression gezielt mit modernen Therapien zu unterbinden.
Zahl der Aderlässe
Hier thematisieren Prof. Reiter und Prof. Grießhammer die Anzahl der Aderlässe bei der Behandlung einer PV.
Zu Anfang einer PV, so erläutert es Prof. Grießhammer, sind viele Aderlässe nötig, um die Blutwerte zu stabilisieren. Doch spätestens nach einem Jahr gelten mehr als 5 – 6 Aderlässe pro Jahr als viel, denn sie führen langfristig vor allem zu Eisenmangel, ohne andere wichtige Probleme wie erhöhte weiße Blutkörperchen oder Thrombozyten, Milzvergrößerung oder Allel-Last zu beeinflussen. Daher sind Aderlässe heute eher eine Einstiegsbehandlung, während moderne Therapien wie Interferon oder Ruxolitinib langfristig besser geeignet sind.
Prof. Reiter erläutert, dass das Hauptziel der Therapie bei PV die Vermeidung thromboembolischer Komplikationen, beispielsweise Herzinfarkt oder Schlaganfall, ist. Dabei sollen der Hämatokrit unter 45 % gesenkt sowie die Leukozyten- und Thrombozytenwerte normalisiert werden.
Bei einem Erstgespräch mit Betroffenen mit PV liege daher nicht die Lebenszeit im Fokus, sondern dieses thromboembolisches Risiko, klärt der Experte weiter auf. Der Übergang in eine Myelofibrose tritt oft erst nach vielen Jahren auf, und eine akute Leukämie ist glücklicherweise sehr selten.
Zytoreduktive Gabe
Prof. Reiter und Prof. Grießhammer fassen hier die wichtigsten Informationen rund um die PV-Therapie mit Ropeginterferon alfa-2b sowie mögliche Nebenwirkungen zusammen.
Die Behandlung mit Ropeginterferon alfa-2b erfolgt anhand eines benutzerfreundlichen Injektionspens. Die Dosen können variabel von 50 bis 250 µg eingestellt werden. Prof. Grießhammer empfiehlt, mit einer niedrigen Dosis zu beginnen. Er betont: Eine Interferon-Therapie braucht Zeit, um zu wirken. Ein zu schnelles Eindosieren führt zu Problemen und einer hohen Abbruchrate. Die Titration (oder Dosisfindung) dauert oft Monate, was Patienten frühzeitig erklärt werden muss, um unrealistische Erwartungen zu vermeiden. Wer schnelle Ergebnisse erzielen möchte, sollte zunächst Hydroxyurea einsetzen und zusätzlich Interferon langsam steigern.
Interferon ist eine körpereigene Substanz, die grippeähnliche Nebenwirkungen, wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, aber auch depressive Symptomatik, verursachen kann. Daher ist es bei bereits bestehenden psychischen Erkrankungen wichtig, mit den jeweiligen Psycholog:innen eng zusammenzuarbeiten. Als weitere Nebenwirkungen, bei denen eine Absprache mit anderen Fachrichtungen notwendig sein kann, nennen die Experten Schilddrüsenunter- oder -überfunktion, Hautreaktionen, sowie erhöhte Leberwerte.
Prof. Grießhammer erzählt, dass er positive Erfahrungen damit gemacht hat, Ropeginterferon alfa-2b bei guter molekularer Remission abzusetzen. Hierfür gibt es jedoch keine konkrete Definition. Der Experte nennt eine Allel-Last unter 10 % oder spätestens unter 5 %, bei der Ropeginterferon alfa-2b pausiert oder abgesetzt werden kann. Im Falle des Wiederanstiegs der Blutwerte kann die Therapie einfach wieder eingeleitet werden.
Fortschreitende PV
Zum Ende greifen die beiden Experten das Vorgehen bei einer fortschreitenden PV mit zunehmender Verfaserung des Knochenmarks auf.
Prof. Grießhammer erläutert, dass Menschen mit einer neu diagnostizierten PV nicht erst seit kurzem, sondern schon Jahre oder Jahrzehnte mit dieser Erkrankung gelebt haben. Die Schäden, die dabei im Körper aufgetreten sind, können daher nicht innerhalb weniger Monate rückgängig gemacht werden.
Anschließend berichtet Prof. Reiter über die zunehmende Verfaserung des Knochenmarks, die sogenannte sekundäre Myelofibrose, welche bei einem Teil der Patient:innen trotz Therapie auftreten kann. Warnzeichen dafür wären beispielsweise ein plötzlicher Hämoglobin-Abfall oder eine vergrößerte Milz. Generell soll hier aber das Gesamtbild betrachtet werden.
Die Vermehrung von Fasern muss genau analysiert werden, da sie nicht immer negativ ist. Ab Grad 2 ist eine Behandlung mit JAK-Inhibitoren sinnvoll, da sie die Krankheitsprogression verlangsamen können. Wichtiger als die Behandlung ist jedoch die Verhinderung der Verfaserung, was nur mit Interferon- oder JAK-Inhibitor-Therapie möglich ist. Prof. Grießhammer betont: Die Verfaserung soll patientenindividuell bewertet werden.
Prof. Reiter schlussfolgert, dass die moderne Therapie mit Interferon und JAK-Inhibitoren eine neue Ära markiert, da sie die Allel-Last senken können. Eine Reduktion der Allel-Last ist mit weniger thromboembolischen Komplikationen und einem geringeren Risiko für den Übergang in Myelofibrose verbunden.
AOP Health ist der europäische Pionier im Bereich integrierter Therapien für seltene Erkrankungen und Intensivmedizin und setzt sich für die Verbesserung der Aufklärung über seltene chronische Erkrankungen ein.
Vielfach fehlen den betroffenen Patient*innen grundlegende Informationen zu ihrer Situation und den verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten. Mit einer Online-Sprechstunde zur Seltenen Erkrankung Polycythaemia vera gibt AOP Health Betroffenen die Möglichkeit, ihre individuellen Fragen an erfahrene Experten auf dem Fachgebiet der myeloproliferativen Erkrankungen zu stellen. Weitere Information zum Krankheitsbild von seltenen Erkrankungen (myeloproliferative Neoplasien) finden Sie unter https://mpn.network.